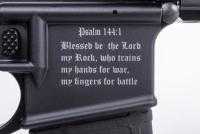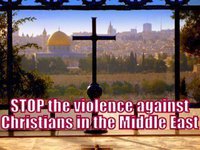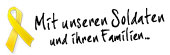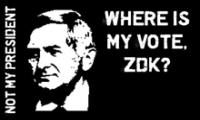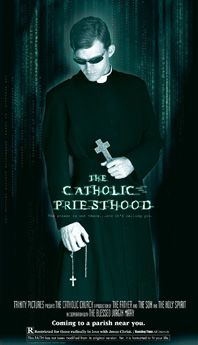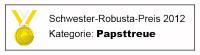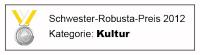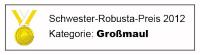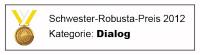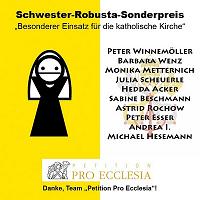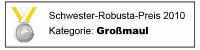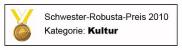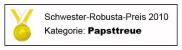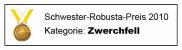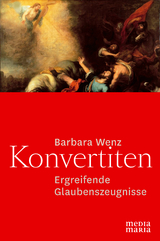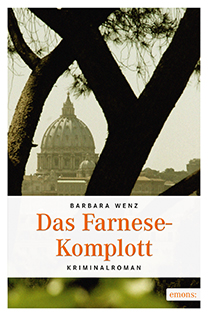Ich frage mich langsam, wo Lauro Martines,
seines Zeichens emeritierter Professor für Europäische Geschichte an der Universität Los Angeles, Experte für die italienische Renaissance, eigentlich lebt? Auf dem Mond?
Gut, sein Buch über die Pazzi-Verschwörung ist recherchiert, fundiert, gut zu lesen, etc. etc. Das kann man ja nun aber auch erwarten.
Meines Wissens ist es auch das einzige Buch, das sich diese Verschwörung ausnahmslos zum Thema erkoren hat. Das könnte alles prima sein, aber von einem Historiker erwarte ich doch, dass er Unterschiebungen und Unterstellungen unterlässt, oder sie zumindest deutlich kenntlich macht. Da schreibt er in schönster Kolumnistenmanier, als es um die Beschlagnahmung der wertvollen Handschriftensammlung der de' Pazzi geht:" "Und wenn die Handschriftensammlung von Messer Piero [...] nicht vollständig zur Auktion kam, lag das gewiss am Kennerblick eines hochgebildeten einflussreichen Bürgers, der die kostbarsten Stücke schon vorher unter der Hand erworben hatte."
S191.
Hehehe, also der pöse Pursche Lorenzo rächt sich nicht nur blutig an den Pazzi, nein, er bereichert sich auch noch in seine eigene Tasche. Steht da. Und auf S. 194 steht dann: "Ob auch ein Teil der kostbaren Handschriften Piero de' Pazzis oder andere exquisite Kunstwerke [...] der verhassten Familie in die Medici-Kollektion Eingang fanden, sei es durch unverblümtes Einstreichen oder aber durch Ersteigerung zu selbstredend günstigen Konditionen, ist nicht eindeutig belegt."
Ja, WAS DENN NU?
Wo Signore Martines an seinen Quellen bleibt, ist er unschlagbar. Er hat es sogar fertig gebracht, das gesamte Vermögen der Pazzi-Familie minutiös über Jahrzehnte hinweg aufzulisten. Er hat die Quellen SOGAR übersetzt! Wofür wir ihm dankbar sind. Er gibt auch frank und frei zu, dass er natürlich auf Seiten der Pazzi steht in seiner Beurteilung, weil ja schließlich über die Jahrhunderte hinweg die Medici versucht haben, ihre Sicht der Dinge darzustellen, naturgemäß also ein schlechtes Licht auf die konkurrierende Familie zu werfen, weshalb man das nun doch zu Recht mal gerade rücken sollte. Aber: Wo bleibt denn die ausgewogene Gesamtschau auf die Ereignisse? Etwa hier, als er die Jahre nach der Vertreibung der Medici subsummiert:
S 241: "[...] war die Republik jedoch noch lange nicht tot, wie es Flucht und Exil der Medici sowie das erstarkte Wiederaufleben einer republikanischen Regierung in den Jahren 1494/95 belegen. Als Reaktion auf die weit verbreitete Forderung nach einer "offenen" Republik, rief das neue (teilweise savonarolische) Regime als eine seiner ersten Amtshandlungen den Großen Rat ins Leben, eine legislative Körperschaft mit 3500 Mitgliedern, die bis 1512 das verfassungsrechtliche Fundament der neuen Republik bildete."
Ich finde es mal (Geschichte Leistungskurs) ziemlich gewagt, im 15. Jahrhundert von einer republikanischen Verfassung sprechen und diese gar einfordern zu wollen. Das "teilweise savonarolische Regime" dürfen wir uns getrost als fürchterliche Talibanherrschaft vorstellen, da hilft auch der etablierte "Große Rat" überhaupt gar nichts.
Das ist alles so unausgewogen, das schwankt so hin und her, ja sicher, Lorenzo konnte nicht anders - natürlich KONNTE er nicht anders, er wickelte schließlich die gesamte Außenpolitik für Florenz ab, und JA, er hatte Klienten, meine Güte, das hatte JEDER, auch die Pazzi damals, so funktionierte das System, was sollte man erwarten? Einen Ausschuss für Menschenrechte, eine ständige Vertretung am Den Haager Gerichtshof? Trennung von Exekutive, Legislative, Judikative? WIE denn auch? Martines präsentiert uns hervorragende Quellen, aber mit seinen Conclusiones startet er einen einzigartigen Eierlauf. Der letzte Absatz lautet folgendermaßen:
"All seinen bemerkenswerten Eigenschaften zum Trotz - oder, genauer gesagt, dank ihnen - war Lorenzo der einzige Mann, der die Republik Florenz jemals an den Rand des Abgrunds brachte. Zuerst, in dem er Furcht und Hoffnung säte, dann, indem er diese Furcht ausnutzte, um die persönlichen Ziele der Bürger für seine eigenen Zwecke einzuspannen. Und während er so seine ganze Kraft aufbot, die öffentliche Macht von Florenz in den Besitz der Medici zu bringen, wurde er nicht müde zu behaupten, das Wohl von Florenz und das Wohl der Familie Medici seien ein und dasselbe. Und irgendwann glaubte er das dann auch selbst."
Was für ein wohlklingener Ausklang. So schlüssig, so eingängig. Das Problem ist nur, dass Martines uns auf circa 200 Seiten vorher ausnahmslos Quellen präsentiert hat, die belegen, dass es nun einmal de facto so war, dass Wohl und Wehe der Republik (ein Terminus, den er gerne anführt und im politikwissenschaftlichen und postrevolutionären Sinne anwendet, als WÜSSTE er es nicht besser) eben in der Tat von Lorenzos Existenz abhingen, die durch das Attentat auf ihn substantiell gefährdet worden war. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man das derart missinterpretieren kann. Lauro Martines, dessen Talent und Fleiß ich hier besonders in Bezug auf die Quellenforschung gar nicht in Abrede stellen will, kann sich doch nicht allen Ernstes hinstellen und die "Republik" Florenz im 15. Jh. als ein Gebilde missverstehen, welches er im besten Falle nach der französischen Revolution ansiedeln will? Mit einer Urteilskraft, die sich auf den Erfahrungen des 20. Jahrhundertes zementiert?
Natürlich, Lorenzo de' Medici war der bessere Berlusconi, wenn wir so wollen. Er war charismatischer, er war diplomatischer, er war höflicher, er war intelligenter, belesener, charmanter und liebenswürdiger. Aber wir können uns doch nicht hinstellen im Jahre 2000 und die Maßstäbe anlegen, die wir in über 500 Jahren gelernt haben, anzuwenden? Man hatte seinen Bruder ermordet, sein eigenes Leben bedroht, das Urteil eines anderen Historikers lautet: Nichts besseres konnte ihm passieren, er hat ausschließlich gewonnen.
Da möchte ich dann widersprechen. Nichts war gewonnen, man hat ihm einen Knöchel an den Kirchenstaat und den geifernden Papst geschnallt, einen Arm an den französischen König, einen anderen an das Köngreich Neapel, um ihn zu vierteilen. Lorenzo de' Medici hat nicht für sich selbst, sondern für SEINE Republik Florenz alles in die Waagschale geworfen und die Reise zu Neapels König angetreten, seinem damaligen Erzfeind, um diesen Krieg zu beenden, für Florenz zu beenden. Was ihn das gekostet hat - Tage, in denen er eloquent, charmant zu sein hatte und Nächte, in denen er aus Kummer und Sorge verzweifelt Tränen vergoss, und es kommt noch hinzu, dies alles geschah in Folge der Verschwörung in der er Opfer war, nicht Täter. Wäre er umgekommen, das Urteil der heutigen Generationen wäre gewiss wohlwollender ausgefallen. Und das nehme ich Martines übel. Er hätte ein gutes Buch schreiben können, auch und vor allem aus Pazzi-Sicht. Und deshalb vermag ich mich der folgenden Rezension leider nicht anzuschließen und reihe mich ein, meinetwegen auch als Vertreter der Konservativen, in die Kopfschüttler.
Und nein, ein letztes noch, er erzählt NICHT furios. Er ist durchaus lesbar.
"... ein großer Wurf. Zum einen ist seine Darstellung kunstvoll komponiert: Ereignisberichte wechseln sich mit Einblendungen von Persönlichkeitsprofilen ab. Und auch ausgiebige Reflexionen des Autors, der seine Rolle als Leiter der Ermittlungen stets aufs Neue bestimmt, sind reichlich eingestreut. Dazu kommen faszinierende Aktualisierungen: So könnte die Pazzi-Verschwörung etwa als "Terrorakt" gelesen werden. Der Text hat so etwas vom Medien-Layout des 21. Jahrhunderts. Journalistisch im besten Sinn ist vor allem der Stil: Martines erzählt furios - und die vorzügliche deutsche Übersetzung hält dabei durchaus mit. Die konservative Zunft mag den Kopf schütteln - das Buch des emeritierten Autors atmet Jugendfrische, vermag zu fesseln und ist trotzdem "seriös" ... ein ungewöhnlich farbiges und facettenreiches Buch ..."
Damals, 12/2004
Gut, sein Buch über die Pazzi-Verschwörung ist recherchiert, fundiert, gut zu lesen, etc. etc. Das kann man ja nun aber auch erwarten.
Meines Wissens ist es auch das einzige Buch, das sich diese Verschwörung ausnahmslos zum Thema erkoren hat. Das könnte alles prima sein, aber von einem Historiker erwarte ich doch, dass er Unterschiebungen und Unterstellungen unterlässt, oder sie zumindest deutlich kenntlich macht. Da schreibt er in schönster Kolumnistenmanier, als es um die Beschlagnahmung der wertvollen Handschriftensammlung der de' Pazzi geht:" "Und wenn die Handschriftensammlung von Messer Piero [...] nicht vollständig zur Auktion kam, lag das gewiss am Kennerblick eines hochgebildeten einflussreichen Bürgers, der die kostbarsten Stücke schon vorher unter der Hand erworben hatte."
S191.
Hehehe, also der pöse Pursche Lorenzo rächt sich nicht nur blutig an den Pazzi, nein, er bereichert sich auch noch in seine eigene Tasche. Steht da. Und auf S. 194 steht dann: "Ob auch ein Teil der kostbaren Handschriften Piero de' Pazzis oder andere exquisite Kunstwerke [...] der verhassten Familie in die Medici-Kollektion Eingang fanden, sei es durch unverblümtes Einstreichen oder aber durch Ersteigerung zu selbstredend günstigen Konditionen, ist nicht eindeutig belegt."
Ja, WAS DENN NU?
Wo Signore Martines an seinen Quellen bleibt, ist er unschlagbar. Er hat es sogar fertig gebracht, das gesamte Vermögen der Pazzi-Familie minutiös über Jahrzehnte hinweg aufzulisten. Er hat die Quellen SOGAR übersetzt! Wofür wir ihm dankbar sind. Er gibt auch frank und frei zu, dass er natürlich auf Seiten der Pazzi steht in seiner Beurteilung, weil ja schließlich über die Jahrhunderte hinweg die Medici versucht haben, ihre Sicht der Dinge darzustellen, naturgemäß also ein schlechtes Licht auf die konkurrierende Familie zu werfen, weshalb man das nun doch zu Recht mal gerade rücken sollte. Aber: Wo bleibt denn die ausgewogene Gesamtschau auf die Ereignisse? Etwa hier, als er die Jahre nach der Vertreibung der Medici subsummiert:
S 241: "[...] war die Republik jedoch noch lange nicht tot, wie es Flucht und Exil der Medici sowie das erstarkte Wiederaufleben einer republikanischen Regierung in den Jahren 1494/95 belegen. Als Reaktion auf die weit verbreitete Forderung nach einer "offenen" Republik, rief das neue (teilweise savonarolische) Regime als eine seiner ersten Amtshandlungen den Großen Rat ins Leben, eine legislative Körperschaft mit 3500 Mitgliedern, die bis 1512 das verfassungsrechtliche Fundament der neuen Republik bildete."
Ich finde es mal (Geschichte Leistungskurs) ziemlich gewagt, im 15. Jahrhundert von einer republikanischen Verfassung sprechen und diese gar einfordern zu wollen. Das "teilweise savonarolische Regime" dürfen wir uns getrost als fürchterliche Talibanherrschaft vorstellen, da hilft auch der etablierte "Große Rat" überhaupt gar nichts.
Das ist alles so unausgewogen, das schwankt so hin und her, ja sicher, Lorenzo konnte nicht anders - natürlich KONNTE er nicht anders, er wickelte schließlich die gesamte Außenpolitik für Florenz ab, und JA, er hatte Klienten, meine Güte, das hatte JEDER, auch die Pazzi damals, so funktionierte das System, was sollte man erwarten? Einen Ausschuss für Menschenrechte, eine ständige Vertretung am Den Haager Gerichtshof? Trennung von Exekutive, Legislative, Judikative? WIE denn auch? Martines präsentiert uns hervorragende Quellen, aber mit seinen Conclusiones startet er einen einzigartigen Eierlauf. Der letzte Absatz lautet folgendermaßen:
"All seinen bemerkenswerten Eigenschaften zum Trotz - oder, genauer gesagt, dank ihnen - war Lorenzo der einzige Mann, der die Republik Florenz jemals an den Rand des Abgrunds brachte. Zuerst, in dem er Furcht und Hoffnung säte, dann, indem er diese Furcht ausnutzte, um die persönlichen Ziele der Bürger für seine eigenen Zwecke einzuspannen. Und während er so seine ganze Kraft aufbot, die öffentliche Macht von Florenz in den Besitz der Medici zu bringen, wurde er nicht müde zu behaupten, das Wohl von Florenz und das Wohl der Familie Medici seien ein und dasselbe. Und irgendwann glaubte er das dann auch selbst."
Was für ein wohlklingener Ausklang. So schlüssig, so eingängig. Das Problem ist nur, dass Martines uns auf circa 200 Seiten vorher ausnahmslos Quellen präsentiert hat, die belegen, dass es nun einmal de facto so war, dass Wohl und Wehe der Republik (ein Terminus, den er gerne anführt und im politikwissenschaftlichen und postrevolutionären Sinne anwendet, als WÜSSTE er es nicht besser) eben in der Tat von Lorenzos Existenz abhingen, die durch das Attentat auf ihn substantiell gefährdet worden war. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man das derart missinterpretieren kann. Lauro Martines, dessen Talent und Fleiß ich hier besonders in Bezug auf die Quellenforschung gar nicht in Abrede stellen will, kann sich doch nicht allen Ernstes hinstellen und die "Republik" Florenz im 15. Jh. als ein Gebilde missverstehen, welches er im besten Falle nach der französischen Revolution ansiedeln will? Mit einer Urteilskraft, die sich auf den Erfahrungen des 20. Jahrhundertes zementiert?
Natürlich, Lorenzo de' Medici war der bessere Berlusconi, wenn wir so wollen. Er war charismatischer, er war diplomatischer, er war höflicher, er war intelligenter, belesener, charmanter und liebenswürdiger. Aber wir können uns doch nicht hinstellen im Jahre 2000 und die Maßstäbe anlegen, die wir in über 500 Jahren gelernt haben, anzuwenden? Man hatte seinen Bruder ermordet, sein eigenes Leben bedroht, das Urteil eines anderen Historikers lautet: Nichts besseres konnte ihm passieren, er hat ausschließlich gewonnen.
Da möchte ich dann widersprechen. Nichts war gewonnen, man hat ihm einen Knöchel an den Kirchenstaat und den geifernden Papst geschnallt, einen Arm an den französischen König, einen anderen an das Köngreich Neapel, um ihn zu vierteilen. Lorenzo de' Medici hat nicht für sich selbst, sondern für SEINE Republik Florenz alles in die Waagschale geworfen und die Reise zu Neapels König angetreten, seinem damaligen Erzfeind, um diesen Krieg zu beenden, für Florenz zu beenden. Was ihn das gekostet hat - Tage, in denen er eloquent, charmant zu sein hatte und Nächte, in denen er aus Kummer und Sorge verzweifelt Tränen vergoss, und es kommt noch hinzu, dies alles geschah in Folge der Verschwörung in der er Opfer war, nicht Täter. Wäre er umgekommen, das Urteil der heutigen Generationen wäre gewiss wohlwollender ausgefallen. Und das nehme ich Martines übel. Er hätte ein gutes Buch schreiben können, auch und vor allem aus Pazzi-Sicht. Und deshalb vermag ich mich der folgenden Rezension leider nicht anzuschließen und reihe mich ein, meinetwegen auch als Vertreter der Konservativen, in die Kopfschüttler.
Und nein, ein letztes noch, er erzählt NICHT furios. Er ist durchaus lesbar.
"... ein großer Wurf. Zum einen ist seine Darstellung kunstvoll komponiert: Ereignisberichte wechseln sich mit Einblendungen von Persönlichkeitsprofilen ab. Und auch ausgiebige Reflexionen des Autors, der seine Rolle als Leiter der Ermittlungen stets aufs Neue bestimmt, sind reichlich eingestreut. Dazu kommen faszinierende Aktualisierungen: So könnte die Pazzi-Verschwörung etwa als "Terrorakt" gelesen werden. Der Text hat so etwas vom Medien-Layout des 21. Jahrhunderts. Journalistisch im besten Sinn ist vor allem der Stil: Martines erzählt furios - und die vorzügliche deutsche Übersetzung hält dabei durchaus mit. Die konservative Zunft mag den Kopf schütteln - das Buch des emeritierten Autors atmet Jugendfrische, vermag zu fesseln und ist trotzdem "seriös" ... ein ungewöhnlich farbiges und facettenreiches Buch ..."
Damals, 12/2004
ElsaLaska - 22. Mär, 23:49