40 Jahre Liturgiereform - 10 Fragen an S. E. Annibale Bugnini. Frage 2.
Warum ist das Schlussevangelium entfallen? Im Schlussevangelium der Alten Messe lesen wir:
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.
Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht.
Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Haben wir es nicht mehr notwendig gehabt?
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.
Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht.
Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Haben wir es nicht mehr notwendig gehabt?
ElsaLaska - 5. Dez, 22:09


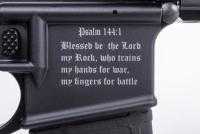

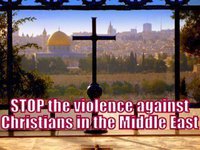
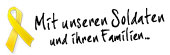
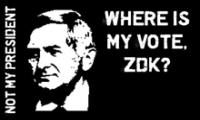
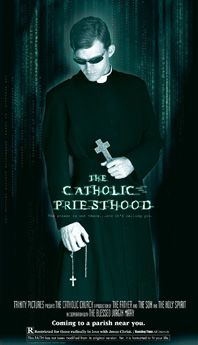


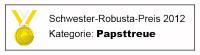
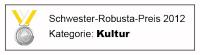
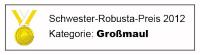
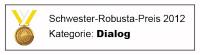
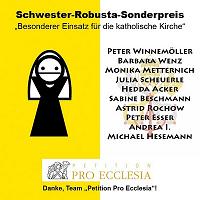
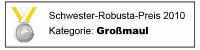
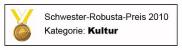
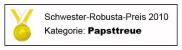
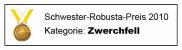

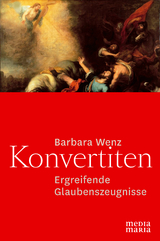
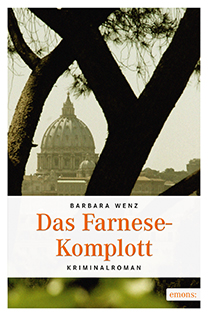




Ich bin nicht dieser Meinung, kann sie aber verstehen.
Ärgere ich mich ja schon ein wenig, wenn zum dritten Mal im Jahr die Seligpreisungen als Evangelium kommen. Aber das ist mehr wegen dem, was stattdessen hätte kommen können.
Fazit: es geht mit und ohne Schlußevangelium.
Aber warum das Schlußevangelium nach Segen und Entlassung kam, hab ich noch nie verstanden.
>>Der Gedanke der Reformer war anscheinend, daß nach der Entlassung die Leute nun wirklich in Frieden gehen und das Evangelium verkündigen sollten
Das mit dem Ite missa est sozusagen alles vorbei ist, warum sollte das so sein? In vielen italienischen Gemeinden ist es ja auch noch so, dass man auch VOR Beginn der Liturgie den Rosenkranz gemeinsam betet, also die Zeit vor und auch nach der eigentlichen liturgischen Handlung war gerade die Zeit für die Laien, da waren sie doch besonders gefragt. In der Alten Messe ist bzw. war es so, dass die Leoninischen Gebete gemeinsam gesprochen wurden (Das wird Frage 3).
Ich weiß nicht, ich finde, dass das mit dem Ite missa est - und Jetzt is aber Schluss! die Menschen eher dazu verführt, noch während des letzten Liedes hinauszustürmen? (Eine Vorbereitung auf die Hl. Messe erfolgt ja sowieso nicht mehr oder wenn, dann nur privat und unsichtbar)
Es ist eben nicht der Schlusspunkt - sondern der Beginn von etwas, finde ich?
Schließlich beten auch heute noch Priester bzw. Liturgischer Dienst schon etwas bevor sie den Kirchenraum betreten und damit die Liturgie eröffnen.
>>Der Gedanke der Reformer war anscheinend, daß nach der Entlassung die Leute nun wirklich in Frieden gehen und das Evangelium verkündigen sollten
Vielleicht aber, FingO, war genau deshalb das Schlussevangelium dabei eine Aussendungshilfe?
"Das mit dem Ite missa est sozusagen alles vorbei ist, warum sollte das so sein? In vielen italienischen Gemeinden ist es ja auch noch so, dass man auch VOR Beginn der Liturgie den Rosenkranz gemeinsam betet, also die Zeit vor und auch nach der eigentlichen liturgischen Handlung war gerade die Zeit für die Laien, da waren sie doch besonders gefragt."
Alles ist sicherlich nicht vorbei, aber die Liturgie bzw. die Messe eben schon. Natürlich kann man vorher kommen oder später gehen und dann beten, ob bei sich oder in Gemeinschaft. Und das wäre auch so eine Art Liturgie, nur halt eben nicht Teil der Messe.
Daß gerade aber vorher und nachher und beim Rosenkranz die Laien gefragt wären, das kann ich nicht akzeptieren. Man geht primär in das Kirchengebäude um die Messe (oder andere Gottesdienste) zu feiern und da ist die Mitwirkung der Gläubigen (was nicht Geschäftigkeit etc heißen muß) auch gefragt. Zuschauer sollte es bei der Messe nicht geben.
In der Alten Messe ist bzw. war es so, dass die Leoninischen Gebete gemeinsam gesprochen wurden (Das wird Frage 3).
"Ich weiß nicht, ich finde, dass das mit dem Ite missa est - und Jetzt is aber Schluss! die Menschen eher dazu verführt, noch während des letzten Liedes hinauszustürmen?"
Ähem, das ist auch ihr gutes Recht. Das Ite besagt genau das: Ihr könnt gehen, wenn es sein muß (und da sei jeder selbst Richter) gleich auf der Stelle. Ein letztes Lied kann da nicht zum Bleiben verpflichten - jetzt mal das Te Deum ausgenommen.
Insofern finde ich es auch problematisch, wenn mancherorts es nicht schnell genug gehen kann nach dem Ende der Messe (womöglich noch jeder Messe) das Allerheiligste auszusetzen.
Natürlich ist das "Ite" der Beginn von etwas - aber wir Christen haben nunmal auch eine Aufgabe da draußen.
Auf Frage 3 bin ich gespannt, weil mir der Begriff Leonidische Gebete grade nichts sagt.
@str.
Wegen des Schlussliedes: Ich kenne es aus dem (deutschen) NO-Ritus so, dass noch ein Gruß an Maria gesungen wird. Da fände ich es allerdings grob, einfach hinauszustürmen. Denn während das Lied gesungen wird, verharrt der Priester mit den Ministranten noch vor dem Altar und zieht dann hinaus. Also für mich ist die Feier tatsächlich erst dann zuende, und nicht mit dem Ite missa est. Die Italiener nehmen es nicht so genau, man kann kommen und gehen wann man möchte, ist absolut üblich hier. Und ähnlich klasse wie klingelnde Handies während der Wandlung ;-)
Sinn des Schlussevangeliums.
>>Ursprünglich hatte das Schlussevangelium vor allem den Charakter eines Segens. Wenn der Anfang des Evangeliums feierlich gelesen wird, dann steht der Beginn stellvertretend für das Ganze [pars pro toto]. Deshalb ist es mancherorts Brauch, am Fronleichnamsfest an vier Altären in die vier Himmelsrichtungen jeweils der Anfang der vier Evangelien zu lesen.
Auch inhaltlich finden wir im Schlussevangelium einen höchst passenden Abschluss der heiligen Messe, denn es enthält eine wunderbare Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Messopfers und der wichtigsten Geheimnisse des Glaubens. Der hl. Apostel und Evangelist Johannes wird zu Recht dargestellt mit dem Symbol des Adlers, denn vom Adler sagt man, er könne mit bloßem Auge in die Sonne schauen. Tatsächlich gleicht der Beginn seines Evangeliums einem adlerhaften Blick in die ewige Sonne der Gottheit: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.”
In der Gesamtstruktur der Messe steht das Schlussevangelium parallel zum Stufengebet. Während dort die Bitte stand: „Sende aus Dein Licht und Deine Wahrheit“, finden wir im Schlussevangelium gleichsam die Antwort, denn es spricht vom „wahren Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt”.<<
Steht auf www.alte-messe.de.
Wer hat's denn gehört?
Für wen wird also das Evangelium gelesen? Für Gott, falls er es möglicherweise vergessen hat? Für die Gemeinde? Warum wird dann ein Lied gesungen?
Die Entscheidung war nachvollziehbar, auch wenn ich von Bugnini nicht viel halte.
@FranzS
Soweit ich mich an meine letzte Alte Messe entsinne, wird das Schlussevangelium auch nicht "in Richtung Altar gemurmelt".
Was das rausgehen angeht, ging es mir ja auch darum, ob man darf. Und ich finde, nach dem Ite darf man. Ansonsten, warum gibt es das Ite überhaupt?
Nicht das man soll. Ich persönlich warte sowieso bis der Priester weg ist, da ich mich vor dem Gehen noch ein/zwei Mal Richtung Tabernakel hinknie und da "stört" mich der Priester, wenn er noch vor dem Altar steht.
Zu dem was Franz von Sales schrieb: das hat es bestimmt auch gegeben (mit dem Ministranten als "Volksvertreter") und es war und ist in meinen Augen ein Mißbrauch. Man kann das Schlußevangelium auch nicht mit Gebeten, die der Priester für sich spricht, etwa bei der Gabenbereitung, beim eigenen Kommunionempfang, vergleichen. Das Schlußevangelium ist aber vom Missale eindeutig als Teil mit Gemeindebeteiligung vorgesehen.