"Die Kirche muss den Geist der ecclesia militans
zurückgewinnen" lautet der Titel eines Artikels von Dr. Armin Schwibach, in dem er ein Gespräch mit Roberto de Mattei, u.a. Professor für Geschichte der Kirche und des Christentums an der „Università Europea di Roma“ und Mitarbeiter des Päpstlichen Instituts für Geschichtswissenschaften, Träger des Gregoriusorden, wiedergibt.
Die bislang bei mir auf Facebook intensiv diskutierteste Passage, es wird nicht die einzige bleiben, ist diese hier:
>>Frage: Trotz eines „Befreiungsschlages“ in den letzten Jahren – nicht zuletzt auch bewirkt durch die Möglichkeiten der Vernetzung im Internet mittels der sozialen Medien, dessen Sie sich in breitem Maße bedienen – kann eine Unfähigkeit zu organisiertem und gemeinsamem Widerstand auf „konservativer“ Seite festgestellt werden: ein mangelnder „Kampfwille“, den auch Sie immer wieder hervorheben und der bis heute andauert.
Worin sehen Sie die Ursachen für diese Situation? Warum scheint es so schwer zu sein, dem Modernismus auf rationaler, philosophischer und theologischer Ebene zu begegnen?
de Mattei: Meines Erachtens besteht die Hauptursache der Niederlage der Konservativen und die Wurzel der Schwäche der Kirche in der heutigen Zeit im Verlust jener theologischen, für das christliche Denken charakteristischen Sicht, die die Geschichte bis zum Ende der Zeiten als unaufhörlichen Kampf zwischen den beiden „Städten“ im Sinne des heiligen Augustinus interpretiert: der Stadt Gottes und der Stadt Satans. <<
Es empfiehlt sich, das Interview insgesamt und im ganzen Zusammenhang zu lesen.
Hier sei noch zitiert die Auffassungen von Prof. de Mattei zur Frage nach der Zukunft der Liturgie:
>>Das Grundproblem scheint mir darin zu bestehen, eine theologische und ekklesiologische Sicht zurückzugewinnen, die in der Dimension des Transzendenten und des „Sacrum“ gründet. Das bedeutet, dass es notwendig ist, die Grundprinzipien der katholischen Theologie zurückzuerobern, angefangen bei einer exakten Konzeption des Heiligen Messopfers.
Darüber hinaus ist es notwendig, dass die Idee des Opfers die Gesellschaft in der heute weitgehend aufgegebenen Form des Geistes für das Opfer und die Buße durchdringt. Das und nichts anderes ist die „Erfahrung des Sacrum“, deren unsere Gesellschaft dringlich bedarf. Ohne sie ist es schwer, sich eine Rückkehr zur authentischen Liturgie vorzustellen, in deren Mittelpunkt die dem einzig wahren Gott gebührende Anbetung steht.<<
Ganzer Beitrag hier.
Die bislang bei mir auf Facebook intensiv diskutierteste Passage, es wird nicht die einzige bleiben, ist diese hier:
>>Frage: Trotz eines „Befreiungsschlages“ in den letzten Jahren – nicht zuletzt auch bewirkt durch die Möglichkeiten der Vernetzung im Internet mittels der sozialen Medien, dessen Sie sich in breitem Maße bedienen – kann eine Unfähigkeit zu organisiertem und gemeinsamem Widerstand auf „konservativer“ Seite festgestellt werden: ein mangelnder „Kampfwille“, den auch Sie immer wieder hervorheben und der bis heute andauert.
Worin sehen Sie die Ursachen für diese Situation? Warum scheint es so schwer zu sein, dem Modernismus auf rationaler, philosophischer und theologischer Ebene zu begegnen?
de Mattei: Meines Erachtens besteht die Hauptursache der Niederlage der Konservativen und die Wurzel der Schwäche der Kirche in der heutigen Zeit im Verlust jener theologischen, für das christliche Denken charakteristischen Sicht, die die Geschichte bis zum Ende der Zeiten als unaufhörlichen Kampf zwischen den beiden „Städten“ im Sinne des heiligen Augustinus interpretiert: der Stadt Gottes und der Stadt Satans. <<
Es empfiehlt sich, das Interview insgesamt und im ganzen Zusammenhang zu lesen.
Hier sei noch zitiert die Auffassungen von Prof. de Mattei zur Frage nach der Zukunft der Liturgie:
>>Das Grundproblem scheint mir darin zu bestehen, eine theologische und ekklesiologische Sicht zurückzugewinnen, die in der Dimension des Transzendenten und des „Sacrum“ gründet. Das bedeutet, dass es notwendig ist, die Grundprinzipien der katholischen Theologie zurückzuerobern, angefangen bei einer exakten Konzeption des Heiligen Messopfers.
Darüber hinaus ist es notwendig, dass die Idee des Opfers die Gesellschaft in der heute weitgehend aufgegebenen Form des Geistes für das Opfer und die Buße durchdringt. Das und nichts anderes ist die „Erfahrung des Sacrum“, deren unsere Gesellschaft dringlich bedarf. Ohne sie ist es schwer, sich eine Rückkehr zur authentischen Liturgie vorzustellen, in deren Mittelpunkt die dem einzig wahren Gott gebührende Anbetung steht.<<
Ganzer Beitrag hier.
ElsaLaska - 19. Jan, 20:02


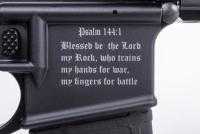

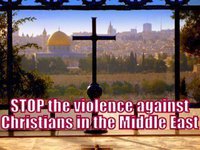
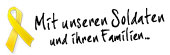
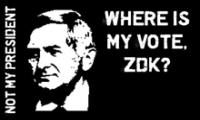
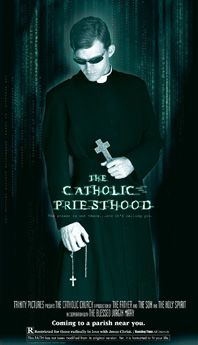


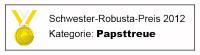
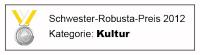
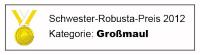
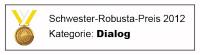
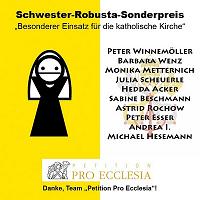
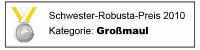
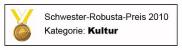
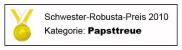
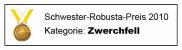

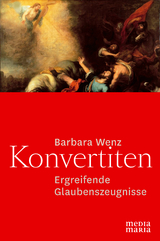
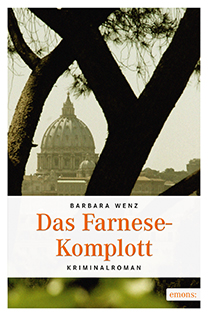




When at Nachtbrevier, do as Elsa says ...
Es scheint, als habe ich mit meinen Bedenken zu Punkt oben recht gehabt:
"It is devoid of logical sense, let alone theological, to wish to contrast, as some do, Tradition and the "living" magisterium, as if Tradition were the past and the living magisterium were the present. Tradition is the magisterium present, past, and, we could say, future."
Ich schrub dazu
"Insbesondere in letzterem Satz löst er etwaige Spannungen einfach dadurch auf, daß die Tradition das heutige Lehramt bestimmt."
Nun heißt es in dem Mattei-Interview auf kath.net (https://www.kath.net/detail.php?id=34825):
"Es bedarf keiner theologischen Wissenschaft, um zu begreifen, dass im unangenehmen Fall eines – wahren oder scheinbaren – Kontrastes zwischen dem „lebenden Lehramt“ und der Tradition der Primat der Tradition zugewiesen werden muss, dies aus einem einfachen Grund: Die Tradition, die das in seiner Universalität und Kontinuität betrachtete „lebende Lehramt“ ist, ist an sich unfehlbar, während das sogenannte „lebende“ Lehramt – verstanden als die aktuelle Verkündigung des kirchlichen Hierarchie – dies nur unter bestimmten Bedingung ist. Die Tradition steht nämlich stets unter dem göttlichen Beistand; für das Lehramt trifft dies nur dann zu, wenn es sich außerordentlich äußert oder wenn es in ordentlicher Form in der Kontinuität der Zeit eine Glaubens- oder Sittenwahrheit lehrt.
Die Tatsache, dass das ordentliche Lehramt nicht beständig eine dem Glauben entgegengesetzte Wahrheit lehren kann, schließt nicht aus, dass dasselbe Lehramt nicht „per accidens“ dem Irrtum verfallen kann, wenn die Lehre in Raum und Zeit begrenzt ist und nicht in außerordentlicher Form spricht."
Das ist babylonische Begriffsverwirrung hoch drei (und man muß kein Theologe sein, um das zu merken - Historiker sehen das auch).
Einen klaren Primat hat keine der drei Säulen katholischer Lehre (interessant, daß die Schrift nie vorkommt bei Mattei), da sie alle ineinander verschlungen sind: das Lehramt basiert auf Schrift und Tradition (also sind letztere primär), aber es interpretiert sie auch verbindlich (als ist das Lehramt primär). Die Tradition mag zeitlich vor der Schrift liegen, aber nur die Schrift ist konkret und fixiert greifbar, während die Tradition erst etwas mühsam festgestellt werden müßte. (Hatte neulich eine "Diskussion" mit einer Sedevakantistin, die das mal wieder ziemlich verdeutlich hat.) Ein Buch, wo die Tradition drinsteht, gibt es nicht. Im Unterschied zum "lebenden Lehramt", ist die Tradition eben nicht etwas lebendiges, welches ich aktiv befragen und welches mir aktiv antworten könnte. Weshalb so oft Tradition (wie auf der anderen Seit Schrift) als Deckmantel für "meine Meinung" dient.
Mattei hat auch seltsame Vorstellungen, wenn er ordentliches und außerordentliches Lehramt gegeneinander ausspielt, um sie der "Tradition" unterzuordnen.
Er schreibt, daß Lehramt sei nur ausnahmsweise unfehlbar, weil das ordentliche Lehramt (OLA) auch irren könne. Es kommt nun darauf an, was man unter dem OLA versteht: entweder einfach die Gesamtheit aller jemals von kirchlich Lehrenden gemachten Lehraussagen (die thematisch unpassenden bleiben außen vor) oder aber man meint damit die Lehraussagen, in denen sich die Lehre der Kirche ausdrückt. Beides ist möglich, aber letztere, engere Gruppe ist nicht aus sich heraus festzustellen, man müßte erst einen Maßstab anlegen.
Beim außerordentlichen Lehramt (Päpste ex cathedra, mit allen Bischöfen oder mit Ökumenische Konzilien) besteht das Problem nicht, da hier die Lehramtlichkeit explizit herausgestellt wird.
Und wir sieht es mit der Tradition aus: dies ist der Glaubensschatz, den Christus den Aposteln gegeben hat, der sich aber im Laufe der Zeit auch ent-wickelt. Die Tradition ist nicht einfach so alles, was im Laufe der Kirchengeschichte anfällt und mitgezogen wird. Wie will Mattei aber feststellen, was apostolische Tradition ist. Er steht vor dem gleichen Problem, wie jemand der beim OLA die lehramtlichen Aussagen heraussuchen wollte.
Es ist ein und dasselbe, was Mattei einmal benutzt, um das Lehramt abzuqualifizieren und was er andererseits als an sich inspiriert hinstellt.
Nun wäre es verkehrt, die Aussagen des außerordentlichen Lehramts einfach absolut zu setzen. Das (außerordentliche) Lehramt interpretiert Schrift und Tradition, aber muß sich diese Interpretation auch sachlich rechtfertigen lassen. Theoretisch wäre denkbar, daß das Lehramt anfängt Mumpitz über die Schrift zu lehren. Wir nehmen aber im Glauben an, daß dies nicht geschehen wird. Dieser Glaube ist der Glaube an die Verheißung Christi, daß seine Kirche nicht überwunden werden wird.
Im Anbtracht dessen, daß Christus diesen Beistand der ganzen Kirche verheißen hat, ist es doch etwas seltsam wenn Mattei meint:
"Die Tradition steht nämlich stets unter dem göttlichen Beistand; für das Lehramt trifft dies nur dann zu ..."
Wo hat Christus jemals der Tradition speziell diesen Beistand zugesagt? Nicht doch der ganzen Kirche?
Eine Interpretation einzelner lehramtlicher Äußerungen (einschließlich des jüngsten Konzils) hat sicher, wie von Benedikt XVI. angemahnt "in Kontinuität", "im Licht der Tradition“ geschehen, aber ebenso erschließt sich die Tradition nur dadurch, daß das Lehramt selbst das Kriterium, der Maßstab für diese ist, einschließlich des II. Vaticanums. Nur wenn alle drei Säulen den gleichen Glauben tragen, kann die Verheißung Christi als erfüllt gelten, nicht aber wenn eine der Säulen zum Herrn über die anderen aufgebaut wird.
PS. Es lebe der Eskopismus!
@str
Jetzt rackerst Du Dich seit endlosen Jahren hier ab! Jetzt ists Zeit - wegen der Überschrift Deines Beitrages und des PS halt sowieso:
♥ !
De Mattei hat im Prinzip auch recht, wenn er die Tradition für immer unfehlbar erklärt im Gegensatz zum Lehramt. Natürlich ist sie das - sonst wäre sie ja keine Tradition. Ihr dagegen einen "göttlichen Beistand" zuzuschreiben ist tatsächlich begriffsverwirrend; denn die Tradition ist ja in diesem Sinne unveränderlich und nicht lebendig und braucht daher keinen Beistand. Man redet auch nicht von einem göttlichen Beistand für die Heilige Schrift, allenfalls von einem göttlichen Beistand für den Schriftleser (was ich nicht von vornherein als protestantische Meinung leugnen würde; man kann diesem aber offenkundig keine Unfehlbarkeit zuschreiben). Mit der Feststellbarkeit entsteht dann eben das Problem mit der Tradition.
Ein anderes Problem entsteht mit der Division von Depositum und Tradition im volkstümlichen Sinn des Wortes; darauf hat Papst Paul VI. den EB Lefebvre mit Recht hingewiesen. (Ist dabei aber, es sei in Demut gesagt, im Eifer des Gefechts meines Erachtens ein bißchen zu weit gegangen. Er unterscheidet, Ap. Schr. Cum te, zwischen a) dem Unaufgebbaren und d) dem, was auf einen neuen Stand gebracht werden kann und muß. Beides gibt es; mir fehlt dabei ein wenig b) das, was an sich nicht unaufgebbar ist, was wir aber keineswegs aufgeben wollen [was zuweilen sogar mit dem Gefühl einhergehen kann, so etwas aufzugeben sei - im nicht strafrechtlichen Sinne - Verrat; man ersetzt auch nicht die weiß-blaue Fahne Bayerns durch sagen-wir eine schwarz-weiß-rote mit dem fränkischen Rechen in der rechten Oberecke] und c) das, was in freier Entscheidung geändert werden kann oder auch nicht.)
Es ist (meines Erachtens) nicht unrechtmäßig, den volkstümlichen Sprachgebrauch von den Traditionen beizubehalten, denn das Depositum ist nicht einfach nur ein bestimmtes Überlieferungsgut, das mit dem Rest gar nichts zu tun hätte, sondern wird in einem Gesamtpaket mitüberliefert - allein, in *diesem* Sinn ist die Tradition tatsächlich genauso fehlbar bzw. (zumindest mit feierlichen Formen des letzteren) eher noch mehr als das Lehramt, wo dem letzteren nicht Unfehlbarkeit zukommt.