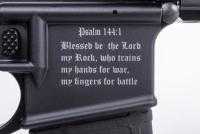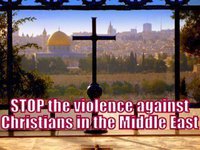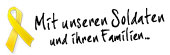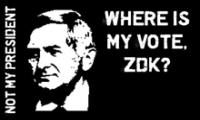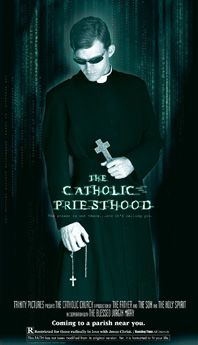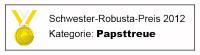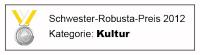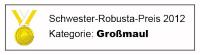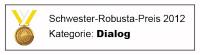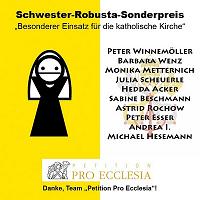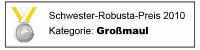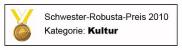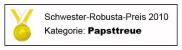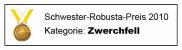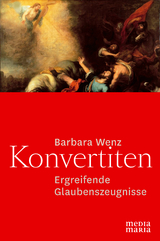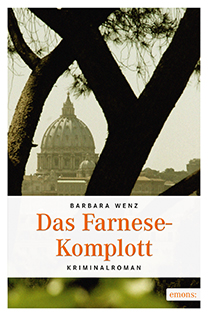Studium
Diese bekannte Frage - es ist der komplizierte Titel eines Buches von Philip K. Dick, das, weniger kompliziert, unter dem Titel Blade Runner verfilmt wurde, fiel mir spontan ein, als ich den lustigen (wegen des kleinen betenden Roboters) und dabei sehr nachdenklichen Beitrag von Dr. Blume auf dem Wissenslog las:
Beten Roboter, wenn sie beten?
Die Fragestellung hat es in sich.
ElsaLaska - 20. Apr, 14:35
"Zwischen dem ersten Konzil von Nicäa 325 und dem ersten Konzil von Konstantinopel 381 wurden nicht weniger als achtzehn unterschiedliche arianische Glaubensbekenntnisse verfasst, die sich teilweise widersprechen. Die wesentlichsten Richtungen dabei waren die radikalen Arianer, die sich wieder in Exukontianer (Gott-Sohn, geschaffen aus dem »Nichtseienden«), Anomoianer (von griechisch ἀνόμοιος [anomoios], unähnlich nach allem und nach dem Wesen) und Heterousiasten (von griechisch ἑτερο-ούσιος [hetero-ousios], ein anderer nach dem Wesen als Gott-Vater) unterteilten, die Homöaner (von griechisch ὁμοῖος [homoios], ähnlich), die vertraten, dass der Vater und der Sohn ähnlich seien, und die der trinitarischen Lehre nahestehenden Semi-Arianer oder Homöusianer (von griechisch ὁμοι-ούσιος [homoi-ousios], wesensähnlich), die vertraten, dass der Sohn und der Vater wesensähnlich, aber unterschiedlich seien. Die verschiedenen Richtungen lagen nicht nur mit den Nizänern, sondern auch untereinander im Streit."
Das ist sehr großartig. Ich liebe solche Wirrsale. Sie klingen immer irgendwie wie Prosa von Douglas Adams.
ElsaLaska - 3. Apr, 14:56
"Lucian stand an der Wiege der sogenannten antiochenischen Exegetenschule, welche die ausschweifende Allegorese des Origenes und der Alexandriner überhaupt als willkürliche Spielerei verurteilte und mit allem Nachdruck auf eine möglichst objektive, historisch-grammatische Würdigung des biblischen Wortlautes drängte. [...] aus ihrer Mitte sind die größten Exegeten des Altertums hervorgegangen. Andererseits aber hat Lucian auch wieder eine große Schuld auf sich geladen. Er hat bis ans Ende eine streng subordinatianische Christologie verfochten und ist dadurch der eigentliche Vater des Arianismus, der Arius vor Arius, geworden. Die ältesten literarischen Vorkämpfer des Arianismus haben sich selbst Syllukanisten genannt, Angehörige der Schule Lucians."
Otto Bardenhewer: Geschichte der altkirchlichen Literatur.
Man sieht, wieviel Lebenszeit man für notwendige philosophische Grundlagenfragen gewinnt, wenn man nicht nur ausschließlich darüber nachdenken muss, welchem Joghurt oder welchen Frühstückscerealien nun der Vorzug zu geben ist.
ElsaLaska - 3. Apr, 14:46
(speziell Rahner) habe ich folgende interessante Stelle gefunden, für mich war sie jedenfalls interessant, da völlig neu. Falls ich jemals auf dem ZDF einen Gottesdienst anschaue, werde ich darauf achten:
"
Die Katholische Fernseharbeit beim ZDF hat für die Gottesdienstübertragungen die „mystagogische Bildregie“ entwickelt. Sie verzichtet auf eine Kommentierung, die vorher schon erklärt, was die nächste liturgische Handlung bedeutet, sondern erschließt den Sinn einzelner Riten, Handlungen und Gegenstände, indem sie diese in Beziehung zu Bauelementen, z.B. dem Gewölbe, setzt, oder bildliche Darstellungen wie das Kreuz mit einem Gesang verbindet. Die Kamera und die Bildregie leisten die mystagogische Erschließung einzelner Abschnitte des Gottesdienstes. Mystagogische Bildregie ist deshalb möglich, weil die Kirchenräume mit einer theologischen Konzeption gebaut sind und Symbole im Kirchenraum auf die Feier der Eucharistie und verschiedenen anderen Gottesdienstformen bezogen sind."
ElsaLaska - 19. Mär, 18:21
sein "moralischer Gottesbeweis" wird sogar von Theologen abgelehnt (z. B. Karl Barth). Es gibt für den Menschen keinen Weg zu Gott, weder über die moralische Selbstvergewisserung noch über die religiöse Erfahrung. Gott ist deus absconditus.
Karl Barth sieht das Christentum gar nicht als Religion an, sondern quasi als religionskritische Fußnote von Gott selbst.
Ich finde den Ansatz eigentlich ziemlich originell.
ElsaLaska - 15. Mär, 09:02
"Deshalb wird es im nächsten Band, Schöpferische Mythologie, unser Anliegen sein, von der Zeit der Tafelrunde bis zur heutigen Stunde systematisch die Detonation des Atoms zu verfolgen, den langen Prozess, in dessen Verlauf der europäische Mensch die Augen für einen Zustand öffnete und öffnet, der kein Zustand ist, sondern ein Werden. Dieser Prozess ist zugleich das Verschwinden aller früheren Masken Gottes, hinter denen sich, wie man jetzt erkennt, der heranwachsende Mensch selbst verbarg. Einige werden vielleicht den Wunsch verspüren, sich noch immer vor einer Maske niederzuwerfen, aus Furcht vor der Natur. Aber wenn nichts Göttliches in der Natur ist, in der von Gott geschaffenen Natur, wie sollte es dann in der Vorstellung von Gott sein, geschaffen von der Natur des Menschen? 'Bei meiner Liebe und Hoffnung beschwöre ich dich', rief Nietzsches Zarathustra:'wirf den Helden in deiner Seele nicht weg.'"
Joseph Campbell: Mythologie des Westens - Die Masken Gottes.
Nietzsche, wie man sieht, auch nur ein hilfloser Tropf, der ohne Liebe und Hoffnung nicht auszukommen vermag.
ElsaLaska - 14. Mär, 01:45
Da dies ein Eintrag für
kopfherz wird, lasse ich jetzt mal jegliche Polemik gegen die Bibel in gerechter Sprache beiseite, auch wenn es schwer fällt. Also, Gott die Mutter, der gestrenge JHWH, in der Lutherbibel (nicht nur dort, aber ich nehm die Ausgabe, weil ich sie LIEBE):
Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten; aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme; aber sie merkten's nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Hos 11, 1-4
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Jes 66,13
ElsaLaska - 13. Mär, 22:40
Studium - -
0 Trackbacks - 344x gelesen
"Die Frage lautet: 'Kommt die Unfähigkeit, das Unmögliche zu tun, Gott eher zu als dem Unmöglichen die Eigenschaft, von Gott nicht geschaffen werden zu können?' (Utrum prius conveniat Deo non posse facere impossibile quam impossibili non posse fieri a Deo?)* Um welches Problem geht es hier?"
in Beckmann J.P., Einführung die Philosophie des MA.
*Ockham, Ordinatio I, d.43, q.2;OT 4, 640ff.
Allora, zur Erläuterung:
Es ist in der Tat ein Problem der Reihenfolge - und ganz allgemein gesagt zeigt es den Verlauf eines Prozesses: Da laut mittelalterlicher Weltsicht die Welt von Gott geschaffen worden ist, ist sie durchgängig kontingent, also nicht notwendig erschaffen worden. Für Wissen als solches, als wissenschaftliches Beweiswissen, gilt aber nach Aristoteles, dass es ein Wissen von dem sein muss, was notwendigerweise das ist wie es ist und wie es ist. Wie sollte jetzt also in einer nicht-notwendig geschaffenen Welt
eine wissenschaftliche Aussage zu treffen sein (es könnte ja auch alles ganz anders sein)? Darum hat man die Notwendigkeit aus dem Bereich der Dinge herausgehoben und in den Bereich der Aussagen verlegt: Dies wurde aber nicht von allen Denkern so mitvollzogen, weshalb es drei verschiedene Positionen zu dieser Frage gegeben hat:
Heinrich von Gent (theologische Position): Das Unmögliche kann von Gott nicht deshalb nicht erschaffen werden, weil es unmöglich ist, sondern weil Gott nichts Unmögliches tut. Punkt.
Duns Scotus (philosophische Position): Das Unmögliche schließt miteinander Unverträgliches ein (sonst wäre es möglich). Also ist es primär aus sich heraus, aus seiner Eigenschaft her, nicht machbar. Dass das Unmögliche nicht geschaffen werden kann, liegt logisch der Aussage voraus, dass Gott das Unmögliche nicht schafft.
Soweit, so gut. Es wäre überhaupt alles gut, wenn dann nicht noch Ockham hinten raus käme. Ockham ist der Denker, der mich gelehrt hat, dass mittelalterliche Philosophie nicht zu unterschätzen ist. Von allen philosophischen Texten, die ich gelesen habe, kann ich guten Gewissens sagen, dass ich sie - jedenfalls als ich noch etwas jünger und frischer im Hirn war - gut verstanden habe (wir haben in Ethik alles mögliche gelesen, und zwar im Original). Bei Ockham ist es so, dass es entweder an Ockham liegt oder an meinem Alter. Oder an unser beider Alter zusammengenommen ...
Ockham also kommt jetzt mit einer dritten Position: Es handle sich um korrelative Begriffe, beides sind Bestandteile von Aussagen, was wem früher zukommt ist lediglich eine Frage der formalen Struktur von Aussagebestandteilen. Er geht also über die Frage von Gottes Allmacht (von Gent) und über die Frage der ontologischen Fundierung (Scotus) hinaus bzw. zurück auf den logisch-semantischen Hintergrund der Frage, in dem er sagt: Weder geht das Nicht-Erschaffen-Können dem Nicht-Erschaffen Werden-Können voraus, noch umgekehrt. Beides ist nur miteinander aussagbar (korrelativ).
Zumindest habe ich verstanden, dass das ein ganz wesentlicher und wichtiger Schritt hin zur modernen Philosophie war. Auch kleine Gaben werden genommen!
ElsaLaska - 16. Dez, 18:41
"Was die erstere, die wissenschaftstheoretische Bedeutung [von Wissenschaft] angeht, so ist uns bereits begegnet, dass in der mittelalterlichen Terminologie 'subiectum' etwas Intersubjektives meint, mithin objektive Bedeutung hat. Wenn vom 'subiectum scientiae' die Rede ist, so ist genau dasjenige gemeint, was wir im Deutschen als 'Objekt' einer Wissenschaft bezeichnen. Es ist daher in der Überschrift zu diesem Abschnitt vom 'Subjekt/Objekt' der Wissenschaft die Rede."
Beckmann, Jan P. , Einführung in die Philosophie des MA. S. 22
:(
ElsaLaska - 15. Dez, 14:23
"Die Problematik der Zeit zeigt sich für ihn [Augustin] v.a. in der Rede von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Ohne einen Zeitbegriff ist eine solche Rede nicht möglich. Andererseits gilt: Die Vergangenheit ist vorbei, ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht, und die Gegenwart ist im Grunde das Jetzt, also zeitlich unausgedehnt. Wäre die Gegenwart zeitlich ausgedehnt, gäbe es keinen vernünftigen Grund, diese Ausdehnung irgendwo zu begrenzen, die Gegenwart wäre also Ewigkeit. Eigentlich, so Augustin, "besitzt die Gegenwart keinerlei Ausdehnung - praesens autem nullum habet spatium"[Confessiones, XI, 15]. Genaugenommen müsse man von einer Art Gegenwart des Vergangenen, einer Art Gegenwart des Gegenwärtigen und einer Art Gegenwart des Künftigen sprechen; die erstgenannte ist durch das Gedächtnis (memoria), die zweitgenannte durch den unmittelbaren Anblick (contuitus) und die drittgenannte durch die Erwartung (exspectatio) zu begreifen. Dies ist eine These von kaum zu überschätzender Bedeutung für die Folgezeit: Die Zeit wird nämlich hier zu einem Bewusstseinsphänomen erklärt. Indem sich das menschliche Bewusstsein oder der menschliche Geist an etwas (Vergangenes) erinnert oder etwas (Zukünftiges) erwartet oder schließlich etwas (Gegenwärtiges) unmittelbar ansieht, vollzieht er in seinem Bewusstsein etwas Zeitliches. Was immer die Zeit ist, so könnte man Augustins Analyse auf den Punkt bringen, sie hat etwas mit der Tätigkeit unseres Bewusstseins zu tun.
Fußnote dazu:
Augustins Zeit - Analyse, die genauer zu untersuchen hier nicht der Ort ist, hat nicht nur im Mittelalter, sondern bis in unsere Gegenwart hinein die Denker beschäftigt; es sei hier nur auf Husserl und auf Wittgenstein verwiesen. Vgl. E. Husserl, Zur Phänomenologie des Inneren Zeitbewusstseins. Den Haag 1966. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Oxford 1953, Seite 289f."
aus: Beckmann, Jan: Einführung in die Philosophie des Mittelalters. Kursmaterial Hagen.
ElsaLaska - 24. Okt, 15:46